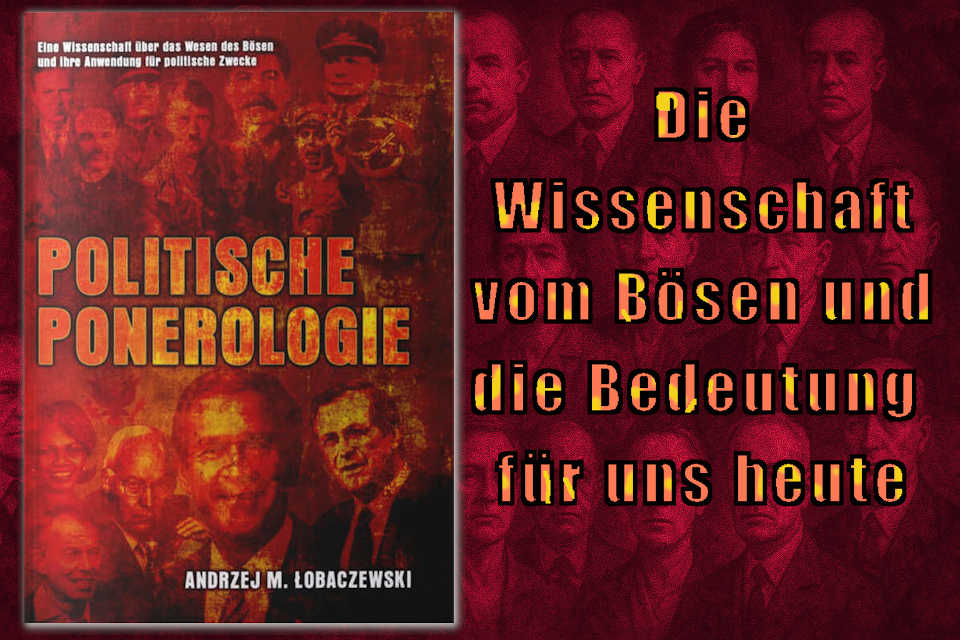Politische Ponerologie
Viele spüren es, aber kaum jemand kann es benennen: Da ist ein feiner Versatz zwischen Worten und Wirklichkeit. Politiker sprechen von Verantwortung, während Entscheidungen offenkundige Widersprüche ignorieren. Konzerne beschwören „Werte“, während unter ihrem Lächeln Existenzen einknicken. Behörden schützen — so der Anspruch — das Gemeinwohl, doch Betroffene erleben Kälte, Formalismus und Sprachnebel. Was, wenn dieses diffuse Unbehagen mehr ist als bloße Stimmung — ein brauchbarer Hinweis?
Hier setzt das Buch „Politische Ponerologie“ an: die Idee, dass das Böse nicht nur als Einzeltat, sondern als Struktur auftreten kann — getragen von Persönlichkeiten, denen Empathie fremd ist, und von Institutionen, die sich unmerklich an deren Logik anpassen. Andrzej M. Łobaczewski beschreibt dieses makrosoziale Böse als realen, wiederkehrenden Prozess in Gesellschaften — und stellt eine unbequeme These ins Zentrum:
„Das einzige Mittel gegen das Böse und seine hinterlistige Vorgehensweise einzelnen Menschen und Gruppen gegenüber ist das Wissen um seine Existenz und seine Natur.“
Schon die Geschichte des Buches selbst belegt die Brisanz des Themas. Die ersten Manuskripte wurden von den kommunistischen Behörden beschlagnahmt oder zerstört, ein weiteres Exemplar fiel mutmaßlich Geheimdiensten in die Hände. Mehrfach musste Łobaczewski das Werk neu verfassen — stets unter dem Risiko, selbst verfolgt zu werden. Erst im Exil gelang es, die Arbeit zu sichern und Jahrzehnte später zu veröffentlichen. Dass ein wissenschaftliches Werk über das Böse selbst wie ein verbotener Text behandelt wurde, zeigt, wie groß die Angst jener Systeme war, entlarvt zu werden.
Łobaczewski beginnt seine Darstellung nicht im Abstrakten, sondern mit Erfahrung: der schleichenden Wirkung von Indoktrination, der Erosion von Klarheit und Solidarität, dem „frostigen Nebel“, der sich über Wirklichkeit und Werte legt. Diese psychologische Kälte — so seine Beobachtung — lässt sich erkennen, analysieren und benennen; genau darin liegt der erste Schritt heraus aus der Ohnmacht.
Auf das Buch von Łobaczewski bin ich eher zufällig gestoßen: In der Sendung Home Office #573 (https://www.youtube.com/watch?v=0AsTieQZ6wQ) erwähnte Robert Stein den Begriff „politische Ponerologie“ – ein Wort, das mir bis dahin völlig unbekannt war. Meine Neugier war geweckt, und ich begann zu recherchieren. Schließlich stieß ich auf das Buch selbst und las es. Der Inhalt hat mich tief beeindruckt. Schon nach den ersten Kapiteln wurde mir klar: Dieses Wissen darf nicht im Schatten bleiben, es sollte mehr Menschen erreichen.
Worum es in diesem Beitrag geht:
Wir schauen hin, wie solche Dynamiken funktionieren (Mechanismen), wo sie historisch auftraten (Perspektive), und was das für deine Selbstbestimmtheit bedeutet. Denn wer versteht, wie Kälte zur Norm wird, erkennt auch die Stellen, an denen Wärme — innere Kohärenz, Urteilskraft, Haltung — den Unterschied macht. (Im Sinne Łobaczewskis: Wissen als Immunisierung.)
Mechanismen des Bösen
Psychopathie steht bei Łobaczewski im Zentrum seiner Analyse des Bösen. Er beschreibt diese Persönlichkeitsstruktur als Mangelwesen: Es fehlt nicht an Intelligenz, nicht an Charme oder äußerer Gewandtheit – sondern an Empathie, an Schuldempfinden, an einem inneren moralischen Kompass. Der Psychopath versteht Begriffe wie Mitgefühl oder Verantwortung zwar sprachlich, doch für ihn bleiben sie bloße Begriffe ohne innere Resonanz. Gefühle, die für andere selbstverständlich sind, bleiben für ihn abstrakte Konstrukte, die er allenfalls nachahmen kann. Genau darin liegt seine gefährliche Stärke: Er wirkt nach außen normal, ja oft überdurchschnittlich kompetent, während er im Inneren von einer Kälte bestimmt ist, die anderen kaum vorstellbar erscheint.
Łobaczewski verweist darauf, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung – er spricht von rund sechs Prozent – entweder voll ausgeprägte Psychopathen oder Träger deutlicher psychopathischer Züge sind. Die moderne Psychiatrie spricht meist von etwa 1 % „echten“ Psychopathen (gemessen an klinischen Kriterien wie der Hare Psychopathy Checklist). Zählt man jedoch Menschen mit deutlichen psychopathischen Zügen (z. B. stark ausgeprägter Narzissmus, Mangel an Empathie, manipulative Tendenzen), steigen die Schätzungen je nach Studie auf 4–6 %. Łobaczewskis Zahl bewegt sich also am oberen Rand dessen, was in der Literatur diskutiert wird.
Auch wenn die exakte Zahl in der Wissenschaft unterschiedlich diskutiert wird, macht sie doch eines klar: Das Phänomen ist keine Randerscheinung, sondern Teil jeder Gesellschaft. Die meisten dieser Menschen bleiben unauffällig, doch einige drängen in Positionen, in denen Macht, Kontrolle und die Möglichkeit zur Manipulation locken. Dort können sie ihre Eigenart entfalten, ohne dass sie sofort erkannt werden.
Die Besonderheit des Psychopathen liegt nicht nur im Fehlen von Gewissen, sondern auch in seiner Anpassungsfähigkeit. Er ist ein Meister der Maske, der gelernt hat, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sprechen, das passende Lächeln aufzusetzen, die gewünschten Gesten zu zeigen. Während ein normaler Mensch unbewusst von inneren Werten geleitet wird, kalkuliert der Psychopath allein nach Nutzen und Vorteil. Sein Blick auf andere ist nicht von Beziehung geprägt, sondern von instrumentellem Denken: Menschen erscheinen ihm als Objekte, als Figuren auf einem Spielbrett, deren Wert im Maß ihrer Verwendbarkeit liegt.
Gerade weil Psychopathen nicht wie „Monster“ auftreten, sondern wie Ärzte, Anwälte, Manager oder Politiker neben uns stehen, entfaltet sich ihre Wirkung oft unsichtbar. Wir erwarten das Böse als Ausnahme, als Fratze. Doch die wahre Gefahr liegt in der Normalität: im alltäglichen Lächeln, hinter dem keine Wärme steckt. So bleibt das, was Łobaczewski beschreibt, so erschreckend aktuell – das Böse trägt keine Hörner, es trägt einen Anzug.
„Psychopathen verstehen moralische Begriffe, doch sie bleiben für sie fremd – bloße Konstrukte, die sie imitieren können, ohne sie zu empfinden.“
Wenn psychopathische Persönlichkeiten nicht nur in Einzelfällen wirken, sondern an die Schaltstellen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelangen, entsteht das, was Łobaczewski als Pathokratie bezeichnet – die Herrschaft der Kranken. In einem solchen System bestimmen nicht mehr Vernunft, Moral oder Gemeinwohl die Richtung, sondern Kälte, Manipulation und Machtgier. Die Strukturen selbst werden krank, weil sie sich an den Eigenarten jener orientieren, die sie führen. Regeln, Gesetze und Institutionen verlieren ihren ursprünglichen Sinn und werden zu Werkzeugen der Kontrolle. Das Recht dient dann weniger der Gerechtigkeit, sondern der Absicherung der Macht.
Besonders tückisch ist, dass eine Pathokratie nicht plötzlich entsteht, sondern sich schleichend ausbildet. Zunächst sind es nur Einzelne, die mit rücksichtsloser Kälte Entscheidungen treffen. Doch sobald diese Personen aufsteigen und Netzwerke bilden, verschiebt sich das Klima: Loyalität zu ihnen wird wichtiger als Integrität, Anpassung bedeutsamer als Wahrheit. Wer auf moralischen Grundsätzen beharrt, gilt bald als naiv oder als Störfaktor. Schritt für Schritt normalisiert sich ein Denken, das ursprünglich als pathologisch erkannt würde. Die Gesellschaft passt sich an, weil offene Konfrontation riskant und anstrengend ist.
Łobaczewski beschreibt, dass in einem pathokratischen System die gesunden Anteile einer Gesellschaft in die Defensive geraten. Menschen mit Empathie und Gewissen erleben Ohnmacht, sie ziehen sich zurück oder arrangieren sich, um zu überleben. Damit verstärkt sich die Spirale: Je länger das System besteht, desto stärker prägt es auch die Denkweisen derjenigen, die es ursprünglich ablehnten. Die Pathologie wird zur Norm – und die Fähigkeit, sie als solche zu erkennen, schwindet.
Das vielleicht Verstörendste an diesem Konzept ist, dass es nicht in einer fernen Diktatur oder nur in der Vergangenheit verortet werden muss. Łobaczewski macht deutlich: Die Gefahr einer Pathokratie besteht überall dort, wo Machtpositionen psychopathischen Persönlichkeiten Tür und Tor öffnen. Ob in einem Staat, einem Konzern oder einer Organisation – die Mechanismen sind dieselben. Und genau deshalb bleibt seine Analyse so brisant: Sie zeigt, dass das Böse nicht nur ein individuelles, sondern auch ein strukturelles Gesicht hat.
Ein weiteres Element in Łobaczewskis Analyse ist der Ansteckungseffekt. Gemeint ist damit die unmerkliche Ausbreitung pathologischer Denkweisen in einer ansonsten gesunden Gesellschaft. Psychopathische Persönlichkeiten verfügen über eine eigentümliche Überzeugungskraft: Nicht weil ihre Argumente besonders logisch wären, sondern weil sie frei von inneren Hemmungen auftreten. Ihre Kälte wirkt auf andere wie Entschlossenheit, ihre Rücksichtslosigkeit wie Stärke. In einer Welt, die Unsicherheit und Ambiguität schwer erträgt, erscheint solch kompromissloses Auftreten für viele als Orientierung – auch wenn es in Wahrheit Ausdruck innerer Leere ist.
So beginnen gewöhnliche Menschen, Elemente dieses Verhaltens zu übernehmen. Wer ständig mit manipulativer Sprache, taktischen Halbwahrheiten und kalter Berechnung konfrontiert wird, verliert nach und nach die eigene Sensibilität für Authentizität. Misstrauen wächst, Worte verlieren ihre klare Bedeutung, Handlungen werden nicht mehr am Gewissen, sondern am Nutzen gemessen. Łobaczewski beschreibt diesen Prozess wie eine psychologische Infektion: Die Pathologie weniger färbt auf die vielen ab, bis sie kaum noch als krankhaft erkannt wird.
Besonders gefährdet sind Institutionen, in denen Anpassung belohnt und Widerspruch sanktioniert wird. Dort etabliert sich eine Kultur, in der nicht mehr gefragt wird, ob etwas richtig ist, sondern ob es „funktioniert“ oder „durchsetzbar“ ist. Mit der Zeit verschwimmen die Grenzen: Was ursprünglich als Lüge durchschaubar war, erscheint irgendwann als pragmatische Notwendigkeit. Was anfangs Empörung hervorrief, wird später mit einem Achselzucken hingenommen.
Der Ansteckungseffekt macht verständlich, warum pathologische Systeme so stabil erscheinen können. Nicht, weil alle ihre Mitglieder psychopatisch wären – sondern weil viele gelernt haben, deren Logik nachzuahmen. So entsteht eine Art Ersatzmoral, in der Loyalität, Schweigen und Effizienz die alten Werte von Empathie, Wahrheit und Gerechtigkeit verdrängen. Genau dieser Mechanismus macht Pathokratien so schwer zu durchbrechen: Sie nähren sich nicht nur von den wenigen, die sie anführen, sondern auch von den vielen, die sich ihnen anpassen.
Die tatsächliche Gefahr psychopathischer Persönlichkeiten liegt nicht darin, dass sie als „Monster“ leicht erkennbar wären. Im Gegenteil: Ihre größte Stärke ist die Fähigkeit zur Tarnung. Psychopathen treten nicht mit finsterem Blick und blutigen Händen auf, sondern als Nachbarn, Ärzte, Manager oder Politiker, die äußerlich vollkommen normal wirken. Viele erscheinen sogar überdurchschnittlich charmant, wortgewandt und zielstrebig. Diese Maskierung macht sie für ihre Umgebung schwer fassbar. Wir erwarten das Böse als Ausnahmegestalt – doch die unsichtbare Gefahr liegt gerade in seiner Alltäglichkeit.
Łobaczewski betont, dass Psychopathen in vielen Bereichen besonders erfolgreich sind. Sie scheuen keine Konflikte, haben keine innere Hemmung, unbequeme Entscheidungen durchzusetzen, und nutzen Skrupellosigkeit als Karrierevorteil. Während empathische Menschen in Machtpositionen oft mit moralischen Zweifeln ringen, handeln Psychopathen schnell und ohne Rücksicht. Von außen wirkt das auf viele wie Durchsetzungsstärke oder Führungsqualität. Doch hinter der Maske steht ein inneres Vakuum: Entscheidungen dienen nicht dem Gemeinwohl, sondern allein dem persönlichen Vorteil oder der Aufrechterhaltung von Kontrolle.
Die Unsichtbarkeit wird noch dadurch verstärkt, dass Psychopathen das Vokabular der Moral imitieren. Sie sprechen von Verantwortung, Solidarität oder Freiheit, doch diese Worte haben für sie nur instrumentellen Charakter. Sie sind Werkzeuge, mit denen Zustimmung erzeugt und Kritik entwaffnet wird. Wer nicht gelernt hat, genauer hinzuschauen, lässt sich von dieser Oberfläche täuschen und erkennt zu spät, dass etwas nicht stimmt.
Gerade deshalb ist die unsichtbare Gefahr so wirkmächtig: Sie erlaubt psychopathischen Persönlichkeiten, über Jahre hinweg Vertrauen aufzubauen, Netzwerke zu knüpfen und Macht auszuweiten – ohne je wirklich entlarvt zu werden. Ihr eigentliches Gift ist nicht die spektakuläre Tat, sondern die schleichende Normalisierung von Kälte, Manipulation und Missbrauch. Das Böse, so zeigt Łobaczewski, erscheint nicht in der Fratze des Verbrechens, sondern im alltäglichen Lächeln, das uns glauben machen will, alles sei in Ordnung.
Historische und gesellschaftliche Perspektive
Die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen psychopathische Persönlichkeiten nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen Strukturen prägten. Totalitäre Systeme des 20. Jahrhunderts sind wohl die sichtbarsten Fälle: Regime, die Millionen Menschen ins Verderben stürzten und dabei eine Atmosphäre der Angst zur Normalität machten. Ihre Führer agierten dabei mit absoluter Empathielosigkeit – Entscheidungen wurden gefällt, ohne Rücksicht auf das Leid des Feindes oder das eigene Volk. Propagandistische Parolen stimmten die Massen auf Gehorsam und Mitmachen ein. Der Ansteckungseffekt zeigte sich in Reinform: Slogans und Feindbilder wurden unhinterfragt übernommen, bis sich ganze Gesellschaften in den Dienst einer pathologischen Logik stellten.
Soldaten spielten seit jeher in diesem Mechanismus eine zentrale Rolle. Sie sind es, die den Willen der Psychopathen in die Tat umsetzten – als reine, funktionierende Werkzeuge einer Ideologie, die bereits Millionen das Leben kostete und unermessliches Leid über ganze Kontinente brachte. Ohne ihre Bereitschaft, Befehle auszuführen, wären die Visionen von psychopathischen Herrschenden niemals zur Realität geworden.
Aber auch wirtschaftliche Machtzirkel haben wiederholt gezeigt, wie kalt kalkulierte Interessen ganze Nationen destabilisieren können. Schon der Kolonialismus liefert eindrucksvolle Belege: Handelsgesellschaften wie die Britische Ostindien-Kompanie plünderten systematisch Länder aus, zerstörten lokale Strukturen und hinterließen Millionen Tote sowie jahrhundertelange Armut. Nicht religiöser Eifer oder politische Missionen standen im Vordergrund, sondern die nackte Gier nach Rohstoffen, Gewinnen und Absatzmärkten.
Auch in der Gegenwart zeigt sich dieses Muster. Die Finanzkrise von 2008 offenbarte, wie Spekulation und Risikospiele globaler Banken das Leben von Millionen Menschen ins Wanken bringen können. Während Investmentprodukte gehandelt wurden, deren Risiken längst erkennbar waren, verloren unzählige Familien ihre Arbeit, ihr Zuhause und ihre Ersparnisse. Der Preis für diese Gier wurde nicht von den Verursachern, sondern von der Gesellschaft getragen.
Diese Beispiele verdeutlichen: Pathologische Logiken beschränken sich nicht auf politische Systeme. Auch ökonomische Strukturen können von innerer Kälte geprägt sein – und wenn sich Profit über Menschlichkeit erhebt, sind ganze Nationen dem Risiko der Destabilisierung ausgeliefert.
Ein weiteres Feld ist die Religion – nicht als Glaube an sich, sondern in ihrer Missbrauchbarkeit. Immer wieder wurde Religion von Menschen instrumentalisiert, denen es nicht um spirituelle Werte, sondern um Macht, Kontrolle und Expansion ging. Psychopathische Persönlichkeiten verstanden es, den Mantel des Heiligen über ihre Grausamkeiten zu legen. So wurden Glaubenskriege geführt, in denen nicht der Glaube, sondern der Wille zur Herrschaft entscheidend war. Das zeigt: Selbst Ideen, die ursprünglich Orientierung und Sinn stiften, können zu Werkzeugen der Unterdrückung und Gewalt werden, wenn sie in die Hände von Gewissenlosen geraten.
Philosophisch erinnert dies an Hannah Arendts Begriff von der „Banalität des Bösen“: Grauen entsteht nicht nur durch monströse Figuren, sondern durch Strukturen, in denen Kälte und Gewissenlosigkeit zur Norm werden – sei es im Staat, in der Wirtschaft oder unter dem Deckmantel der Religion.
Selbstbestimmtheit – das eigentliche „Feindbild“ des Psychopaten
Für den einzelnen Menschen bedeutet Politische Ponerologie: Selbstbestimmtheit ist kein nettes Ideal, sondern eine Überlebensfrage. Man könnte einwenden: Auch fremdbestimmte Menschen haben die letzten Jahrzehnte überlebt. Das stimmt – doch ihr Überleben war oft ein Überleben im Modus der Anpassung. Sie arrangierten sich mit Strukturen, die nicht ihren Werten entsprachen, gaben eigene Überzeugungen preis und übernahmen Denkweisen, die sie innerlich verfremdeten. Fremdbestimmtheit mag das biologische Überleben sichern, doch sie fordert einen hohen Preis: die Aufgabe der inneren Freiheit. Selbstbestimmtheit dagegen bedeutet, mehr als nur „durchzukommen“. Sie bewahrt die Fähigkeit, sich selbst treu zu bleiben, die eigene Würde zu schützen und Manipulation zu durchschauen. In einer Welt, die immer wieder von pathologischen Kräften geprägt wird, macht genau das den Unterschied.
Gerade für Psychopathen ist Selbstbestimmtheit das eigentliche Feindbild. Denn wer eigenständig denkt und entscheidet, entzieht sich der Kontrolle. Manipulation funktioniert nur dort, wo Menschen sich führen lassen, ohne kritisch zu prüfen. Wer frei im Denken ist, entzieht sich diesem Spiel – und das unterläuft die Logik der Macht.
Selbstbestimmtheit bedeutet auch, die Maske zu durchschauen. Psychopathische Persönlichkeiten leben von ihrer Fähigkeit, normal zu wirken, moralische Begriffe zu imitieren und Vertrauen zu erschleichen. Doch wer gelernt hat, Worte und Taten sorgfältig zu prüfen, erkennt schneller die Risse in der Fassade. Selbstbestimmte Menschen lassen sich weniger von Parolen blenden, sie hinterfragen Narrative und sehen genauer hin. Diese Klarheit wirkt wie ein Schutzschild gegen die Tarnung des Bösen.
Ein weiterer Aspekt ist die Resonanz. Psychopathen nutzen andere Menschen wie „Nahrung“ – sie saugen Aufmerksamkeit, Energie und Ressourcen ab, ohne selbst etwas Echtes zurückzugeben. Selbstbestimmte Menschen dagegen strahlen eine innere Kohärenz aus, eine Stabilität, die sich nicht so leicht erschüttern lässt. Gerade diese innere Geschlossenheit wirkt für Psychopathen bedrohlich, weil sie ihnen unzugänglich bleibt. Wo Anpassung brüchig macht, schafft Selbstbestimmtheit Standfestigkeit.
In diesem Sinn ist Selbstbestimmtheit weit mehr als eine persönliche Haltung. Sie ist eine Form der Immunität gegenüber Kräften, die das eigene Denken und Fühlen vereinnahmen wollen. Wer sich dieser inneren Freiheit bewusst ist und sie kultiviert, bleibt auch in einer pathologischen Umgebung Mensch im vollen Sinn des Wortes.
Doch an dieser Stelle taucht ein Einwand auf, den viele fremdbestimmte Menschen formulieren würden: „Klingt logisch und verständlich – aber was soll ich allein schon ausrichten?“ Hinter dieser Frage steckt ein Gefühl der Ohnmacht. Das System wirkt zu groß, zu mächtig, zu undurchdringlich. Und hinzu kommt noch etwas: Wer sich über Jahre oder Jahrzehnte angepasst hat, wird sein eigenes Verhalten kaum als „falsch“ akzeptieren wollen. Zu schmerzhaft wäre die Erkenntnis, dass man oft gegen die eigene innere Überzeugung gehandelt hat – sei es aus Angst, aus Pflichtgefühl oder aus dem Wunsch dazuzugehören. Stattdessen neigen wir dazu, diese Anpassung zu rechtfertigen, sie uns selbst und anderen als notwendig, vernünftig oder gar moralisch richtig zu verkaufen.
Viele fremdbestimmte Menschen empfinden an diesem Punkt Zweifel – und das ist verständlich. Wer jahrelang gelernt hat, sich anzupassen, erlebt den Gedanken an Selbstbestimmtheit zunächst wie eine Zumutung. Die Angst ist real: „Kann ich mich allein gegen so viel Macht behaupten? Werde ich nicht sofort scheitern? Werde ich ausgegrenzt?“ Es ist wichtig, diese Bedenken ernst zu nehmen, denn sie gehören zur menschlichen Erfahrung. Genauso wichtig ist es aber auch, sich diesen Ängsten zu stellen.
Denn genau hier beginnt Verantwortung. Nicht die Verantwortung, ein ganzes System im Alleingang zu verändern – sondern die Verantwortung, sich selbst treu zu bleiben. Verantwortung für die eigene Seele, die nicht dauerhaft im Modus der Anpassung überleben kann, ohne Schaden zu nehmen. Verantwortung für die Familie, die spürt, ob jemand aus innerer Stärke oder aus erlernter Unterwerfung handelt. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, die einander als Vorbilder dienen – sei es in Mut oder in Resignation. Und letztlich Verantwortung gegenüber dem eigenen Volk, das nicht von der Anpassung der Vielen lebt, sondern von der Entschlossenheit derjenigen, die innere Freiheit bewahren.
Selbstbestimmtheit ist deshalb kein abstraktes Ideal, sondern eine konkrete Pflicht: Sie zu leben, wo immer es möglich ist, damit andere sich an ihr orientieren können. Jeder kleine Schritt in diese Richtung verändert mehr, als es auf den ersten Blick scheint.
Fazit
Łobaczewskis Buch ist unbequem. Es zeigt uns, dass das Böse nicht abstrakt oder fern ist, sondern mitten unter uns wirkt – oft verborgen hinter Lächeln, Titeln und Institutionen. Es zeigt, wie wenige empathielose Menschen Strukturen prägen können, wenn die vielen anderen sich anpassen. Und es macht deutlich, dass Wissen nicht bloß Erkenntnis ist, sondern Schutz: Wer die Mechanismen versteht, ist weniger anfällig für Manipulation.
Doch Wissen allein genügt nicht. Es will gelebt werden – im Alltag, in den kleinen Entscheidungen, in den Momenten, in denen man sich zwischen Bequemlichkeit und innerer Wahrheit entscheiden muss. Selbstbestimmtheit bedeutet, die Verantwortung anzunehmen: für sich selbst, für die Familie, für die Mitmenschen, für das Gemeinwesen.
Dabei gilt es, wachsam zu sein: Psychopathen sind Meister darin, Begriffe wie „Verantwortung“ oder „Solidarität“ wortgewandt zu besetzen. Was sie damit meinen, dient jedoch nicht dem Gemeinwohl, sondern allein ihren eigenen Interessen. Sie appellieren an Moral, während sie in Wahrheit Empathielosigkeit zur Norm machen. Wer selbstbestimmt lebt, lässt sich diese Begriffe nicht entreißen. Er füllt sie mit echtem Inhalt – mit Rücksicht, Integrität und Mut.
Darum: Warte nicht darauf, dass andere den ersten Schritt tun. Beginne bei dir. Sei dir selbst gegenüber ehrlich, erkenne, wo du dich angepasst hast, und erobere diese Räume zurück. Stärke deine innere Freiheit – und lebe sie sichtbar. Jeder, der dies tut, setzt ein Zeichen. Jeder selbstbestimmte Mensch ist ein Störfaktor in einem pathologischen System – und zugleich ein Lichtpunkt für andere.
Selbstbestimmtheit ist nicht nur eine Möglichkeit.
Sie ist deine Pflicht – und deine Chance, Mensch zu bleiben.
Zum Schluss sei ein Hinweis erlaubt: Nicht jede Politikerin, nicht jeder Vorstand, Unternehmer oder jede Führungskraft ist ein Psychopath. Und nicht jedes Verhalten, das kühl, hart oder empathielos wirkt, muss Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung sein. Menschen handeln aus vielen Gründen, die von Stress über institutionellen Druck bis hin zu erlernten Mustern reichen. Was Łobaczewski beschreibt, ist kein Freibrief für Pauschalurteile, sondern eine Einladung, genauer hinzuschauen – um echte Pathologie von menschlichen Schwächen unterscheiden zu lernen.
Psychopathie ist kein ausschließlich männliches Phänomen. Zwar erscheinen Männer in Studien häufiger, doch das liegt auch daran, dass weibliche Psychopathen oft subtiler agieren und dadurch seltener auffallen. Pathologische Strukturen können von Männern wie Frauen geprägt werden – entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern der Mangel an Empathie und Gewissen.
Weitere Zitate aus dem Buch
In dem Beitrag wurde schon Zitate an passenden Stellen eingefügt. Hier noch einige weitere erwähnenswerte Zitate aus dem Buch:
„Das erste Manuskript dieses Buches wanderte im kommunistischen Polen ins Feuer, fünf Minuten bevor die Geheimpolizei erschien. Die zweite Kopie – von Wissenschaftern unter widrigsten Bedingungen der Unterdrückung aufs Neue zusammengestellt – wurde via Kurier an den Vatikan gesandt. Doch der Empfang des Manuskripts wurde nie bestätigt, alle wertvollen Inhalte waren verloren.
Im Jahr 1984 wurde die dritte Kopie vom letzten überlebenden Wissenschafter, Andrew M. Łobaczewski, aus den verbliebenen Aufzeichnungen und aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Zbigniew Brzezinski blockierte die Veröffentlichung dieser Kopie. Nachdem das Buch ein halbes Jahrhundert lang unterdrückt wurde, ist es nun auch auf Deutsch verfügbar.“
„Es war relativ einfach, das Umfeld und die Herkunft jener Leute zu bestimmen, die diesem Prozeß, den ich damals »Transpersonifikation« nannte, erlagen. Sie kamen aus allen Gesellschaftsschichten, auch Aristokraten und tief religiöse Familien waren dabei. Sie verursachten bei etwa 6% von uns einen Bruch unserer studentischen Solidarität. Die verbleibende Mehrheit litt unter Persönlichkeitsstörungen unterschiedlichen Ausmaßes, was Anlaß für die individuelle Suche nach Werten war, die wir benötigten, um uns selbst wiederzufinden; die Ergebnisse dieser Suche waren unterschiedlich und manchmal auch kreativ.“
„Schon damals hatten wir keinen Zweifel über die pathologische Natur dieses »Transpersonifikationsprozesses«, der in allen Fällen ähnlich, doch niemals identisch ablief.“
„Zu dieser Zeit wurde ich auch mit der Tatsache konfrontiert, daß offenbar jemand mit besonderem Wissen die Bibliothek von allem Material über dieses Thema gesäubert hatte; die Bücher wurden zwar im Index aufgeführt, waren jedoch nicht zu finden.“
„Im Grunde genommen kommt Hervey Cleckley der Idee ziemlich nahe, Psychopathen in jeder Hinsicht als menschlich zu betrachten – nur ohne Seele. Dieser Mangel an ‚Seelenqualität‘ macht den Psychopathen zu einer sehr effektiven ‚Maschine‘.“
„Doch diese 90 Prozent normale Menschen wissen, daß etwas nicht stimmt! … Der Psychopath befällt – wie ein ansteckender Virus den Körper – die Schwächen der Gesellschaft, die daraufhin in einen Zustand verfällt, der immer und unvermeidbar zu Schrecken und Tragödien in großem Maßstab führt.“
„Die Anzeichen von Zerfall bei sensitivem und psychologischem Verständnis, wie auch die römisch imperiale Neigung, von außen auferlegte Vorgaben seinen Bürger aufzuzwingen, kann bereits ab dem Jahre 350 n. Chr. beobachtet werden.“
„Da sich dies jedoch auf ein früheres spirituelles Wissen bezieht, war notwendigerweise jede Annäherung dieser Art auf die menschliche Persönlichkeit einseitig. Leute wie Iwan Pawlow, C. G. Jung und auch andere bemerkten diese Einseitigkeit bald und versuchten eine Synthese. Doch es wurde Pawlow nicht gestattet, seine Überzeugungen zu veröffentlichen.“
„Wo immer eine Gesellschaft versklavt oder den Gesetzen einer überprivilegierten Klasse unterworfen wird, ist die Psychologie die erste Wissenschaft, die von einer Administration zensuriert und belegt wird, die in der Darstellung wissenschaftlicher Wahrheiten das letzte Wort an sich reißt.“
Info zum Buch
Politische Ponerologie
Eine Wissenschaft von der Natur des Bösen und seiner Anwendung für politische Zwecke
Dr. Andrzej M. Łobaczewski
Herausgegeben von Laura Knight-Jadczyk
Polnische Originalfassung: PONEROLOGIA POLITYCZNA – NAUKA O NATURZE ZŁA W ZASTOSOWANIU DO ZAGADNIEŃ POLITYCZNYCH von Dr. Andrzej M. Łobaczewski, Rzeszów, 1984.
Übersetzung ins Englische von Dr. Alexandra Chciuk-Celt, University of New York, 1985. Englische Fassung überarbeitet vom Autor im Jahr 1998. Bearbeitet und kommentiert von Laura Knight-Jadczyk und Henry See, neu verlegt von Red Pill Press, 2006. Deutsche Übersetzung 2008.
Überarbeitete und fehlerbereinigte Fassung:
https://www.pilulerouge.com/de/produkt/politische-ponerologie/