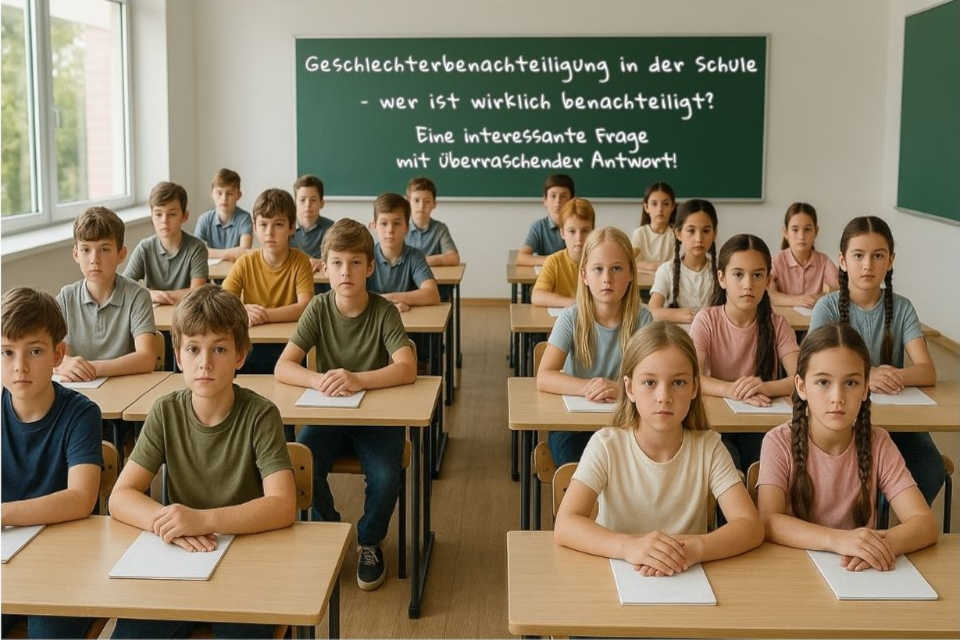Spricht man über Geschlechtergerechtigkeit in der Schule, schießen vielen sofort dieselben Bilder in den Kopf: Mädchen, die in Mathematik und Naturwissenschaften gezielt gefördert werden müssen. Schlagzeilen wie „Mehr Mädchen in die MINT-Fächer!“ haben sich tief ins öffentliche Bewusstsein eingebrannt. Bildungspolitik, Elterninitiativen und mediale Kampagnen drehen sich seit Jahren um das Ziel, vermeintliche Benachteiligungen von Mädchen auszugleichen.
Doch hinter dieser verbreiteten Erzählung verbirgt sich eine andere Wirklichkeit – eine, die im Schatten bleibt, obwohl sie Millionen Kinder betrifft. Es sind nicht die Mädchen, die in den ersten Schuljahren systematisch im Nachteil sind. Es sind die Jungen.
Ein blinder Fleck in der Bildungsdebatte
Spricht man über Benachteiligung im Bildungswesen, richtet sich der Blick fast automatisch auf messbare Leistungen: Noten, Testergebnisse, Sprachkompetenzen. Doch damit rührt man nur an der Oberfläche. Das eigentliche Problem liegt tiefer – im grundlegenden Unterschied des Denkens zwischen Jungen und Mädchen.
Jahrtausende alte Rollenmuster wirken bis heute unterschwellig nach: Jungen sind evolutionär stärker darauf geprägt, Möglichkeiten außerhalb bestehender Grenzen zu suchen, während Mädchen eher darin geübt sind, innerhalb eines Rahmens Sicherheit und Stabilität zu wahren. Dieses unterschiedliche Denken ist keineswegs ein Defizit des einen oder ein Vorteil des anderen Geschlechts – es sind zwei komplementäre Formen, die in ihrer jeweiligen Umgebung sinnvoll und überlebenswichtig waren.
Im heutigen Schulsystem, das stark auf Regeln, Ordnung und Konformität ausgelegt ist, fällt dieser Unterschied jedoch ins Gewicht. Mädchen kommen in den ersten Schuljahren meist besser damit zurecht, weil sie sich leichter in vorgegebene Strukturen einfügen können. Jungen hingegen geraten häufiger in Konflikt, da ihr natürlicher Drang, Regeln zu hinterfragen und alternative Wege zu suchen, schnell als störend oder unangepasst wahrgenommen wird.
So entsteht ein unsichtbarer Nachteil: Nicht, weil Jungen weniger begabt wären, sondern weil ihr Denkstil in einem starren System auf Widerstand stößt. Der eigentliche „blinde Fleck“ in der Bildungsdebatte liegt also darin, dass man diese fundamentalen Unterschiede zu selten berücksichtigt – und damit die systematische Benachteiligung einer ganzen Gruppe übersieht.
Warum Jungen und Mädchen unterschiedlich denken
Markus Meier, ein Pädagoge, hat diesen Unterschied wissenschaftlich untersucht. Er führt die Unterschiede nicht nur auf moderne Sozialisation zurück, sondern auch auf tief verankerte evolutionäre Rollenbilder.
In frühen menschlichen Gemeinschaften hatten Männer vor allem die Aufgabe, Beute zu machen – eine Tätigkeit, die Kreativität, strategisches Denken und die Fähigkeit erforderte, Regeln der Natur zu „umgehen“. Erfolg bedeutete, Wege zu finden, ein Tier zu überlisten, es in eine Falle zu locken oder die Jagdtechnik zu verfeinern.
Frauen hingegen trugen die Hauptverantwortung für die Auswahl eines geeigneten Partners und die Sicherstellung der Fürsorge für Nachwuchs und Gemeinschaft. Diese Rolle verlangte, innerhalb eines klar abgesteckten Rahmens zu denken und zu handeln – Grenzen zu wahren, Risiken für die Familie zu minimieren und Stabilität zu sichern.
Diese Jahrtausende alten Muster wirken, so Meier, bis heute unterschwellig nach. Jungen neigen daher eher dazu, Regeln zu hinterfragen oder nach Schlupflöchern zu suchen, während Mädchen häufiger bereit sind, sich innerhalb gegebener Strukturen zu bewegen.
Das Missverständnis im Klassenzimmer
Aus pädagogischer Sicht wirkt dieses Verhalten oft wie „Schwierigkeit“:
- Jungen suchen ständig nach alternativen Lösungswegen.
- Sie tun sich schwer, sich an vorgegebene Regeln zu halten – oder sich ihnen ohne Hinterfragen zu unterwerfen.
Was im evolutionären Kontext eine Überlebensstrategie war, wird im heutigen Schulalltag schnell als Störung empfunden. Hier prallen zwei Logiken aufeinander: das pädagogische Ziel des Schulsystems, Kinder zu regelkonformen Mitgliedern der Gesellschaft zu formen, die Regeln unhinterfragt akzeptieren – und die natürliche Tendenz vieler Jungen, Grenzen auszuloten, Fragen zu stellen und alternative Wege zu suchen.
Viele Pädagogen empfinden kritisches Nachfragen oder alternative Lösungswege, die im Lehrplan nicht vorgesehen sind, als Konflikt. Sie arbeiten in einem Bildungssystem, in dem ein Abweichen von Vorgaben für sie selbst problematisch sein kann. Lehrkräfte, die früh eigene und oft bessere Methoden anwenden, werden nicht selten bestraft: Ihre Verbeamtung verzögert sich, Beförderungen bleiben aus. Und da sie selbst das gleiche System durchlaufen haben, sind viele Pädagogen längst so angepasst, dass sie Regeln und Lehrmethoden unhinterfragt umsetzen, statt sie kritisch zu reflektieren.
Genau diese Pädagogen sind es dann, die selbstdenkende Schüler als rebellisch und damit als „schwierig“ empfinden. Häufig reagieren sie mit Sanktionen, Disziplinarmaßnahmen oder einem Etikett, das den Schüler langfristig stigmatisiert. Bei manchen Kindern führt das zu Nachgeben und Unterwerfung, bei anderen verstärkt es das als problematisch wahrgenommene Verhalten. Für beide Seiten wird der schulische Alltag dadurch immer belastender.
In beiden Fällen wird der natürliche Impuls, Neues auszuprobieren und Grenzen zu hinterfragen, nicht gefördert, sondern unterdrückt – und damit ein enormes Potenzial verschenkt.
Die stille Wirkung auf die Persönlichkeit
Frühe schulische Erfahrungen hinterlassen Spuren weit über den Unterricht hinaus. Wer als Junge in den ersten Schuljahren immer wieder erlebt, in zentralen Fächern hinterherzuhinken oder wegen seines Denkstils als „schwierig“ zu gelten, entwickelt leicht ein Gefühl der Unterlegenheit. Dieses Gefühl kann sich zu einem hartnäckigen Bestandteil der eigenen Identität verfestigen – mit Auswirkungen auf Selbstvertrauen, Motivation und die spätere Bildungs- und Berufslaufbahn.
Persönlichkeitspsychologisch betrachtet ist das fatal: Selbstwert entsteht zu einem großen Teil aus erlebter Kompetenz. Wenn dieses Erleben schon in der Kindheit gebrochen wird, muss ein Mensch später oft mühsam gegen innere Zweifel ankämpfen.
Zwar zeigen sich bei vielen Jungen, meist ab der 7. Klasse, deutlich stärkere Leistungungen, insbesondere in Mathematik und Naturwissenschaften – doch zu diesem Zeitpunkt ist die Persönlichkeit oft bereits „zurechtgestutzt“. Der natürliche Drang, Herausforderungen eigenständig zu lösen, ist dann häufig durch jahrelange Anpassung, Frustrationserfahrungen oder das Etikett „schwieriger Schüler“ gedämpft. Potenzial, das eigentlich vorhanden wäre, wird so nur teilweise oder gar nicht mehr ausgeschöpft.
Natürlich gibt es auch Jungen, deren Verhalten nicht erst durch die Schule geformt wird. Ein Elternhaus, das schon früh beginnt, den kindlichen Drang nach eigenen Lösungen und das Austesten von Grenzen durch strikte Sanktionen zu unterbinden, kann unbewusst ein generelles rebellisches Muster auslösen. Kommt ein solcher Schüler dann in ein starres, regellastiges Schulsystem, verstärken sich diese Verhaltensweisen oft – bis hin zu einer dauerhaften Opposition gegen Autoritäten. Was als natürliche Neugier und Selbstbehauptung hätte wachsen können, verfestigt sich so zu einem Konfliktmodus.
Ein ausgewogener Blick ist nötig
Es geht nicht darum, die geschlechterspezifischen Denkweisen zu werten oder in Konkurrenz zu stellen. Beide haben ihren evolutionären Sinn und ihre Berechtigung. Auch in der heutigen Zeit bilden sie Vorteile, wenn sie konstruktiv miteinander verbunden werden. Jungen wie Mädchen tragen damit je eigene Stärken in die Gesellschaft – Kreativität und Regelhinterfragung auf der einen Seite, Stabilität und Strukturorientierung auf der anderen.
Doch im schulischen Alltag zeigt sich ein Ungleichgewicht: Die Denkweise der Mädchen passt besser zu den starren Strukturen des Systems und wird dadurch stärker gefördert. Der natürliche Drang vieler Jungen, nach alternativen Lösungen zu suchen, wird hingegen häufig als Störung interpretiert und sanktioniert. Damit entsteht nicht nur ein Nachteil für Jungen, sondern letztlich für die gesamte Gesellschaft, weil ein wertvolles kreatives Potenzial systematisch zurückgedrängt wird.
Hinzu kommt ein weiteres Problem: Das Bildungssystem vermittelt implizit den Eindruck, dass unterschiedliche Denkweisen nicht kooperativ genutzt, sondern in Konkurrenz zueinander gestellt werden. Es scheint, als ob Jungen und Mädchen weniger lernen, ihre unterschiedlichen Stärken zu ergänzen, sondern vielmehr, sich gegeneinander zu behaupten. Diese unterschwellige Konkurrenz setzt sich oft in das Erwachsenenleben fort und kann erklären, warum Partnerschaften zwischen Mann und Frau immer wieder von Konflikten geprägt sind.
In meinem Buch Selbstbestimmtheit – Ein Credo für Frieden und Freiheit beschreibe ich dieses Phänomen ausführlich in Kapitel 7: „Der kleine Krieg – Selbstbestimmtheit im zwischenmenschlichen Miteinander“. Dort wird unter anderem deutlich, wie sehr ungelöste Konkurrenzmuster das private Miteinander belasten können – und wie notwendig es ist, zu einem konstruktiven Miteinander zu finden, in dem Unterschiedlichkeit nicht trennt, sondern ergänzt und verbindet.
Dazu gehören:
- Unterrichtsmethoden, die unterschiedliche Lernstile berücksichtigen.
- Frühzeitige Einbindung von Themen und Materialien, die Jungen und Mädchen emotional abholen.
- Lernformen, die die unterschiedlichen Denkweisen von Jungen und Mädchen bewusst zusammenführen – damit sie sich gegenseitig ergänzen, voneinander lernen und als Bereicherung erlebt werden.
Selbstbestimmtheit beginnt früh
Selbstbestimmtheit im Erwachsenenalter hat ihre Wurzeln in der Kindheit. Jungen lernen früh, dass ihr Drang, Regeln zu hinterfragen und eigene Wege zu suchen, oft als störend bewertet wird. Sie werden dadurch leicht in eine Rolle gedrängt, in der sie entweder Anpassung üben oder als „schwierig“ gelten.
Mädchen hingegen erfahren das Gegenteil: Sie erleben, dass angepasstes Verhalten und das unhinterfragte Befolgen von Regeln belohnt wird. Gleichzeitig wird ihnen durch emanzipatorische Bewegungen aufgezeigt, dass sie sich genau dagegen auflehnen sollen. Dieses Spannungsfeld verstärkt den Konkurrenzkampf zwischen den Geschlechtern – beide Seiten geraten in einen inneren Widerspruch, der enorme psychische Energie kostet.
So wird das eigentliche Problem verdeckt: Statt die komplementären Denkweisen von Jungen und Mädchen als Bereicherung zu erleben, wachsen beide Geschlechter in Strukturen auf, die sie gegeneinanderstellen.
Ein konstruktives Miteinander dagegen setzt psychische Ressourcen frei, die dringend gebraucht werden, um die wirklichen Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Selbstbestimmtheit bei Mann und Frau sorgt daher für ein ergänzendes, kraftvolles Miteinander – und verhindert ein sinnloses, zermürbendes Gegeneinander.
Weiterführender Hinweis
Wer tiefer in das Thema einsteigen und die hier angerissenen Gedanken aus erster Hand hören möchte, findet dazu ein besonders aufschlussreiches Gespräch. Auf apolut.net sprechen die Pädagogen Markus Fiedler und Markus Meier nicht nur über die Geschlechterbenachteiligung im Bildungswesen, sondern auch über weitere hochaktuelle Fragen, die unser Bildungssystem und die Persönlichkeitsentwicklung prägen.
Das Video vermittelt nicht nur Fakten, sondern auch den persönlichen Blickwinkel beider Gesprächspartner. Es ist ein seltenes Stück authentischer Bildungskritik, das mit anschaulichen Beispielen und prägnanten Beobachtungen zum Nachdenken anregt.
Bereits 2015 veröffentlichte Markus Meier sein Buch Lernen und Geschlecht heute – Zur Logik der Geschlechterdichotomie in edukativen Kontexten (ISBN-10: 3826051017). Das Werk ist derzeit leider vergriffen, und ob es eine Neuauflage geben wird, ist unklar – umso wertvoller ist das Gespräch als aktuelle Quelle seiner Überlegungen.
Wer verstehen möchte, wie tief gesellschaftliche Strukturen in die Persönlichkeitsentwicklung hineinwirken, wird in diesem Video reichlich Anregungen finden – und vielleicht die eigene Sicht auf das Bildungswesen neu überdenken.